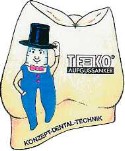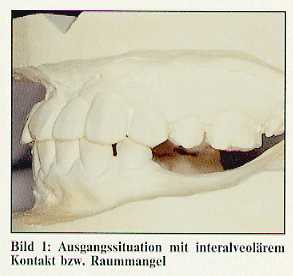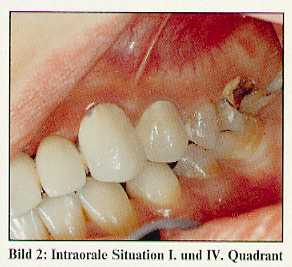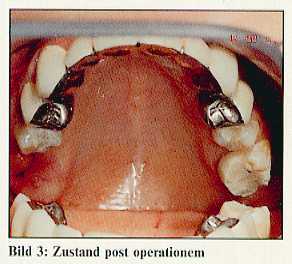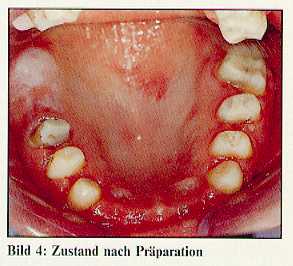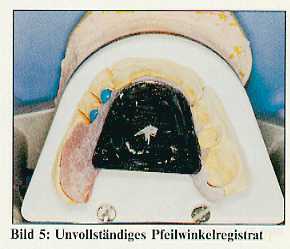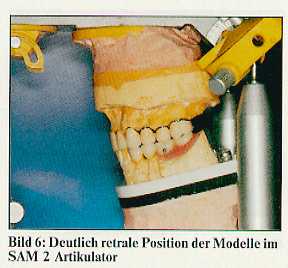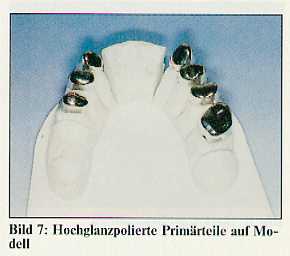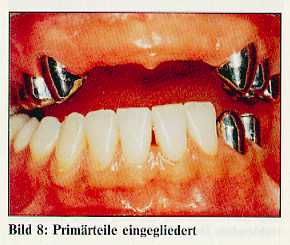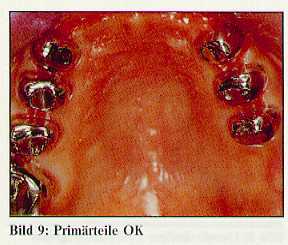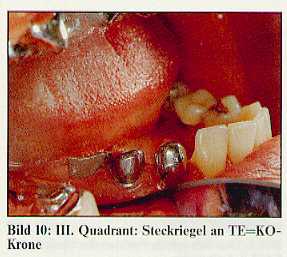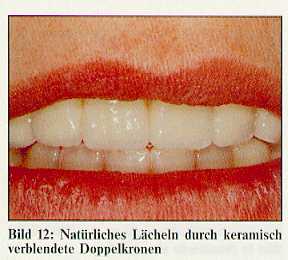|



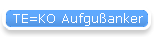
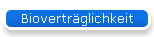

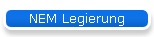
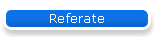

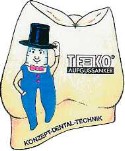
| |
TE = KO
Nach Meinung
namhafter Wissenschaftler gilt, als die zweckmäßigste Lösung des stärker
reduzierten Lückengebisses, der mit
Doppelkronen verankerte Zahnersatz.
-
Das
TE=Ko-Aufgußanker-System
verbindet die Vorteile des Teleskop-Kronen- und Konus-Kronen-Systems auf
geradezu ideale Weise.
-
Direkt aufgegossenes Sekundär-Teil mit
Wandstärken von 0,2 mm. Die erhebliche Materialstärkeneinsparung trägt zur
besseren Ästhetik bei.
-
Konstruktion möglichst graziler Versorgungen
mit weitgehender Gaumenfreiheit
-
Sicheres Erreichen ästhetischer Ergebnisse
(Besonders: Interdentalräume, Zahnlängen, Lippenstütze)
-
Durch die maximale Hygienefähigkeit wird eine
sehr lange Tragfähigkeit prognostiziert.
-
Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte.
(Besonders: Gestehungskosten, Möglichkeiten zur Umarbeitung z.B. bei
Pfeilerverlust)
-
Keine Kontaktkorrosion möglich, da nur ein
Legierungstyp zur Verwendung kommt.
Aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen mit
diesem System, sind wir sicher für Sie einen wesentlichen
Beitrag zu leisten, um Ihren Erfolg und die Zufriedenheit des
Patienten zu steigern.
Neben Funktion, Dauerhaftigkeit und Ästhetik
ist auch die Wirtschaftlichkeit ein wesentlicher Aspekt um sich
für das
TE=Ko-Aufgußanker-System zu entscheiden.
|
Das TE=Ko-Aufgußanker - System
bzw. der TE=Ko-Aufgußanker.
Der TE=Ko-Aufgußanker gehört zum TE=Ko–Aufgußanker-System.
Alle Teile des TE=Ko-Aufgußanker-System
dienen dazu, Prothesen an dem Restgebiß zu “verankern“.
Alle Außenteile bzw. Sekundärteile
des TE=Ko-Aufgußanker-System
werden im Aufgießverfahren hergestellt und stellen in ihrer
Funktion eine reversible reibschlüssige Steckverbindung dar,
deren Kontaktflächen zu den Innenteilen bzw. Primärteilen zum
Teil teleskopierend (daher das “Te“) -also parallelwandig- und
zum Teil konusförmig (daher das “Ko“) gestaltet sind.
Alle Prothesenanker des TE=Ko-Aufgußanker-Systems bestehen aus
zwei Teilen:
Bei herausgenommener Prothese bleiben die
Primärteile auf den im Mund befindlichen Ankerzähnen oder
Implantatpfosten sitzen.
|
Mit dem TE=KO - Aufgußanker stellen unsere Autoren ZA
Jörg Scholz und ZT Norbert Scherer ein keramisch verblendbares
Doppelkronensystem vor, das durch seine stumpfnahe Konstruktion die
Ästhetik der VMK Kronen ermöglicht. Durch den hohen E-Modul der
Legierung Dentitan können äußerst grazile transversalbügelfreie
Freiendprothesen hergestellt werden. Anhand eines Fallberichts
dokumentieren die Autoren den klinischen Werdegang einer TE=KO -
Aufgußankerarbeit.
Die
Doppelkrone ist in verschiedenen Ausprägungen (Konuskrone nach
KÖRBER, Teleskopkrone nach BÖTTGER/ GRÜNDLER) in der Zahnmedizin
präsent. Trotz aller Vorzüge hat sich das Prinzip als
Standardversorgung bei reduziertem Restzahnbestand nicht
durchgesetzt. Nach Auskunft der niedergelassenen Zahnärzte
akzeptiert der Patient die sichtbaren Prirnärkronen im
Frontzahnbereich und unzeitgemäße voluminöse Kunststoffverblendungen
nicht. Gerade jüngeren Patienten ist die vermeintlich überlegene
Ästhetik einer Ankerversorgung bzw. der festsitzende Charakter des
Zahnersatzes wichtiger als die Vorteile der Doppelkronentechnik.
Bei
näherer Betrachtung gibt es für die klassischen
Doppelkronenprinzipien Konus und Teleskop Jndikationseinschränkungen.
Sollen divergierende Pfeiler, wie sie bei oberen Molaren anzutreffen
sind, integriert werden, muß das Primärteil ausladend gestaltet
werden, um den 6o Winkel einzuhalten.
Streng
teleskopierende Versorgungen sind im Frontbereich ästhetisch
unbefriedigend.
Die
traditionelle Doppelkronentechnik verwendet zudem in der Regel
hochgoldhaltige Legierungen, die unkritisch verarbeitet und leicht
mit den Modellgußteilen der Prothesen verlötet werden können.
Zwischen den Primär- und Sekundärkronen tritt Kontaktkorrosion auf,
die Lötstellen solcher Konstruktionen sind im Hinblick auf
Biegefestigkeit und Korrosion systemimmanente Schwachpunkte.
Es fehlte
bisher an einem technisch und konstruktiv innovativen Ansatz, der
die berechtigten Einwände der praktisch tätigen Zahnärzte und der
Patienten berücksichtigt und die konstruktiven Schwierigkeiten der
klassischen Doppelkronentechnik und der erweiterten Systeme
(aufwendige Funkenerosion) behebt.
Den
unbestrittenen zahnmedizinischen Vorteilen der Doppelkronentechnik
stehen also Nachteile gegenüber, die im wesentlichen auf die
mangelnde Ästhetik und den psychologischen Effekt der
„herausnehmbaren Prothese“ beschränkt sind. Es muss also ein System
gefunden werden, mit dem wenigstens die eingeschränkte Ästhetik zu
beherrschen ist. Mit Hilfe der „positiven Ästhetik“ soll dem
Patienten der Schritt zum herausnehmbaren Zahnersatz erleichtert
werden.
Das
Problem
Wir sind
der Frage nachgegangen, ob eine neue Konstruktion die berechtigten
Einwände gegen die Doppelkronentechnik ausräumen kann. Ziel war es,
ein einfaches Prinzip — die Doppelkrone — mit ebenso einfachen
Veränderungen zu einer wirtschaftlich realistischen, allgemein
verwendbaren Lösung zu optimieren. Würden die von uns formulierten
Anforderungen von einem Doppelkronensystem erfüllt, stünde der
positiven Beurteilung durch Zahnärzte und Patienten nichts im Wege.
Es geht uns nicht um ein teueres Hightech - Verfahren, das schon aus
Kostengründen für die allgemeine zahnärztliche Versorgung ungeeignet
ist.
|
Um die
Ästhetik einer VMK - Krone zu erzielen, werden lediglich dünne
Metallgerüste über den Zahn gelegt und verblendet. Diese Gerüste
sind „stumpfnah“ modelliert und gegossen, lassen also der
Verblendkeramik den größtmöglichen Raum.
Zur
ästhetischen Optimierung der Doppelkronentechnik wurden nach
Einführung der NEM - CoCr - Basislegierungen Versuche
unternommen, die vorhandenen Nachteile durch funkenerodierte
Friktionsstifte oder minimale Wandstärken zu beheben. Die
stumpfnahe Fräsung wird von diesen Konstruktionsprinzipien
nicht zwingend ermöglicht, sondern ergibt sich von Fall zu Fall
aus der Präparationsform der Pfeiler, ist also von
Imponderabilien abhängig. Die stumpfnahe Folge der Primärkrone
ist aber die Voraussetzung für die ästhetisch optimale
Gestaltung der Gesamtversorgung, wie sie mit dem Standard der
VMK Krone erzielt werden kann.
Mit
Einbeziehung der Aufgußtechnik entwickelte die
Fa. Konzept-Dentaltechnik GmbH (Hofheim / Ts.)
die
TE=KO - Aufgußanker.
Dabei
handelt es sich um ein spezielles Doppelkronensystem mit
Konuswinkeln von 0 — 6o.
Die
Aufgußtechnik schafft die Präzisionspassung [10] von 0,1 — l0µm
zwischen Primär- und Sekundärelement, so daß der Friktionsweg
auf zirkulär 1,5 mm begrenzt werden kann.
Die
Aufgußtechnik ermöglicht das TE=KO - Prinzip, bei dem der nicht
parallele Anteil der Doppelkrone ebenfalls in stumpfnaher Weise
gefräst wird. Die erforderliche Mindeststärke der Primärkrone
beträgt stumpfnah 0,2 mm. Die technisch realisierbare
Grenzstärke von 0,1 mm streben wir bei CoCr - Basislegierungen
trotz des hohen E-Moduls (220.000 n/qmm) aus Sicherheitsgründen
nicht an. Der Aufpreßdruck während des Zementierens führt zu
Aufbiegeeffekten (siehe Edelmetall) bei Wandstärken unterhalb
0,2 mm [8].
Friktionshilfen sind nicht notwendig. Messungen an klinisch
präparierten TE= KO - Serienkronen zeigten Haltekräfte bis 15 N
bei einer Fugenlänge von 1,5 mm, ohne daß nach 10.000 Fahrten
eine Verringerung der Haltekräfte eintrat. Die Haltekräfte
stiegen geringfügig an, ein Phänomen, das Stüttgen und Hupfauf
mit Einspielvorgängen während der Gebrauchsphase erklären [9].
Dieses System ist in etwa 300 Fällen in der regulären
zahnärztlichen Praxis verwendet worden.
Aufgußtechnik
Die
verwendete Methode mit dem Eigenoxid der Legierung als
Trennmittel ist nur mit der legierungsspezifischen
Oxidationsfreudigkeit der CoCr - Basislegierung Dentitan (Fa.
Krupp Medizintechnik, Essen) zu realisieren. Primär- und
Sekundärkronen werden aus derselben Legierung hergestellt.
Sonderkeramische Trennschichten [10] und aufwendige Techniken
zur Trennung des Primär- und Sekundärteiles [11] werden
überflüssig. Die wirtschaftliche Serienfertigung im gewerblichen
Labor wird nicht durch aufwendige Investitionen in Frage
gestellt. Schweißungen oder Lötungen sind durch Einbeziehung des
Einstückgusses unnötig, die Nachteile der Verarbeitung
verschiedener Metalle für Primär- und Sekundärkronen
(Kontaktkorrosion etc.) sind ausgeschlossen.
Keramische Verblendung
Seit
längerem werden CoCr - Basislegierungen in der Kronen- und
Brückentechnik keramisch verblendet. In den Doppelkronentechnik
erschweren jedoch systemimmanente werkstoffkundliche Prozesse
die dauerhafte Verblendung von Doppelkronen, so daß bisher die
keramisch verblendete Doppelkrone nicht als Standard gelten
kann, wie z.B. die keramisch verblendete Frontzahnkrone.
In der
konventionellen Doppelkronentechnik verformt sich die
Sekundärkrone im Mikrobereich, und es kommt während der
Tragedauer zu Einspielvorgängen.
Herkömmliche Konusarbeiten müssen also an bestimmten Stellen
entlastet werden, um die entstehende Kräfte nicht auf die
keramische Verblendung zu übertragen [5]. Werden die Bereiche um
den Kronenrand und die Spitze der Konuskrone ausgeblockt, kann
auch diese Variante der Doppelkrone keramisch verblendet werden.
Das Maß der notwendigen Ausblockung ist in den Serie jedoch
nicht exakt quantifizierbar, so daß hier großzügig gearbeitet
werden muß. Theoretisch wird beim TE=KO - Aufgußanker durch den
direkten Aufguß auf das vorhandene Primärteil eine absolute
Flächenpassung erzielt. Nach dem Finish bleibt eine
größtmögliche Flächenpassung zurück, so daß TE=KO - Anker von
den Konstruktion her ohne Ausblockungen problemlos keramisch
verblendet werden können.
Die
serienmäßige Herstellung keramischen Verblendung stellt höchste
Anforderungen an den Zahntechniker, da nun wenige Brände
durchgeführt werden sollten, um die Bildung der Oxidschicht auf
der Innenseite den Sekundärteile so gering wie möglich zu
halten.
Das Ergebnis
Durch
das Konstruktionsprinzip — die stumpfnahe Gestaltung von
Primärkronen bei minimalem parallelen Anteilen —wird mit Vita
Omega Keramik die Ästhetik von VMK Versorgungen erzielt. Dieses
Prinzip vereint die Vorzüge der reinen Konustechnik mit denen
den reinen teleskopierenden Krone. Der Patient kann die
„Selbstpositionierung“ der Konuskrone genauso nutzen, wie die
friktiven Haltekräfte des Teleskopes.
|
Die 24jähnige
Patientin suchte uns auf, um ihre vor zehn Jahren angefertigte
Brückenversorgung revidieren zu lassen (Bild 1).
Nach dem
Eingangsbefund stellten sich die Zähne 17, 18, 48 als nicht
erhaltungswürdig dar. Das nicht überkronte Restgebiß war kariös,
es bestand eine Pan. mang. superficialis (Bilder 1+2, PAR-Status
APJ/SBI 1000/0). Der 1. und III. Quadrant hatten flächigen
Zahnkontakt im Level den Alveolarfortsätze (Bilder 1, 2).
Die progene
Bißlage war alio logo durch eine Bißerhöhung von etwa 3 mm und
eine prothetisch erzeugte Frontzahnstufe kompensiert worden, die
den Patientin ein leicht prognathes Profil verlieh. Im Laufe der
Behandlung wurde von internistischer Seite ein Hypothyreodismus
diagnostiziert. Zusätzlich kam es während der Vorbehandlungszeit
zu einer Pneumonie, die Abwehrlage der Patientin war
eingeschränkt. Zwar erwartete die Patientin eine Wiederholung
ihnen bisherigen Brückenversorgung, ließ sich aber von den
Vorteilen einer herausnehmbaren Versorgung überzeugen.
Abweichend vom Behandlungsablauf nach Ramfjord wurde die
chirurgische Therapie in die Parodontalbehandlung integriert, um
die Zahl der notwendigen invasiven Eingriffe zu minimieren. Die
verkürzte Zahnreihe des III. Quadranten mußte nach den Regeln
des BEMA wiederhergestellt werden, um einen Zuschuß zur
prothetischen Versorgung des OK zu erhalten.
Methodik
In der Hygienephase gelang es auch nach
Belagentfernung und Mundhygienemotivation nicht, den SBI
dauerhaft unter 30% zu halten. Den API lag bei 38 %. Nach der
notwendigen Kariestherapie mit Aufbaufüllungen aus
Glasionomerzement (Ketac-Fil, Fa. ESPE, Seefeld) wurden im
Rahmen den Parodontalbehandlung die Zähne 18, 17, 15, 47
chirurgisch entfernt und den Alveolarkamm zum intervaolären
Raumgewinn konturiert (Bild 3). Im Bereich den Zähne 26 und 15
wunde eine modified Widmanflap-Operation durchgeführt, die
übrigen Zähne wurden curettiert.
Aufgrund des
Konstruktionsgedankens der TE=KO-Anker war die Präparation
unproblematisch. Der Substanzabtrag konnte im Bereich einen
regulären VMKKrone bleiben (Bild 4). Es wurden bei den
Präparation schon die Grundformen des TE=KO herausgearbeitet, um
der Patientin späten die Eingliederung zu erleichtern.
Bei dieser
Präparation wunde ein 0-16-450-Hohlkehlschleifer und
Finierer nach Marxkors eingesetzt. Die alte Brücke konnte zur
provisorischen Versorgung der Patientin umgearbeitet werden, um
für die Anfertigungszeit eine befriedigende Lösung zu schaffen.
Zur Verdrängung der marginalen Gingiva wurden ungetränkte
Baumwollfäden mit Mallebrin getränkt. Vor den Abformung
säuberten wir die Pfeilen penibel, um Blut- oder Mallebrinreste
zu entfernen. Die Pfeilen wurden mit Permadyne Garant
und Permadyne body (ESPE, Seefeld) Polyethermassen in
Doppelanmischtechnik im individuellen Löffel abgeformt.
Nach den Kontrolle
den Primärkronenpassung wurde auf die Primärkronen Impregum
Adhesiv (ESPE, Seefeld) dünn aufgetragen und getrocknet, weil
gut sitzende Primärkronen dazu neigen, auf dem präparierten
Stumpf zu verbleiben. Den Fixationsabdruck wurde mit Impregum
Polyether genommen. Bei der Übertragung den arbiträren
Scharnierachsposition
(SAM -
Quickmount - Übertragungsbogen) fiel die deutliche retrale Lage
des Oberkiefers im Schädel auf.
Die Übertragung
wurde mehrfach kontrolliert, um die bemerkenswerte Position des
OK zu verifizieren, der schädelbezügliche Einbau erforderte die
SAM 2 Version mit erhöhten Einbauebene (Bild 6).
Zentrikregistrat (Bilder 5 +
6) nach McGrane/Gerber:
Die Patientin
beschrieb keinen vollständigen Pfeilwinkel. Nach den
behandlerischen Vorgeschichte und dem entsprechenden
„Therapieversuch“ der Progenie war ein regulären Pfeilwinkel
nicht zu erwarten. Gelenkbefunde lagen jedoch nicht von.
Während den
Anprobe der Sekundärteile wurde die VITA-Farbe bestimmt und mit
einem KERR Stat-BR Checkbiß dem Zahntechniker noch eine
Sicherheitskontrolle mitgegeben.
Die Fertigstellung
wurde im Munde der Patientin überprüft. Der Zahntechniker war
bei den Farbbestimmung anwesend und bestimmte mit einem
Skizzenblock Form und Farbe. Die Primärteile wurden zunächst
unzementiert eingesetzt.
Drei Tage späten
wurden die Primärkronen in einem Arbeitsgang mit Harvard Zement
(schnellhärtend) eingesetzt (Bild 10 - Bild 11).
Durch den Zeitverzug zwischen Fixabdruck und
Eingliederung bei meist kompromißbehafteten Provisorien
entstehen minimale Differenzen den Zahnposition.
STÜTTGEN und HUPFAUF [8] empfehlen bei
umfangreichen Arbeiten, zunächst nur einige Pfeilen zu
zementieren.
Wir sind dazu übergegangen, Arbeiten mit mehr als vier
Doppelkronen für drei Tage ohne Zement einzusetzen, um die
initialen Spannungen aufzufangen. Die
Patienten berichten übereinstimmend
über leichte
Spannungen am ersten und zweiten Tag, am dritten Tag können die
Arbeiten gleichzeitig vollständig zementiert werden.
|
Im vorliegenden
Fall ist die mögliche festsitzende Versorgung nach
zahnärztlichen Maßstäben die schlechtere Wahl. Bei dem
Mundhygienezustand der Patientin, der genannten Systemerkrankung
und der reduzierten Abwehrlage wäre der Dauererfolg einer
festsitzenden Lösung fraglich. Die angefertigte
Doppelkronenversorgung kann von der Patientin problemlos
gepflegt werden, die Pfeiler haben eine gute Chance auf
zukünftige parodontale Gesundheit. Eventuelle Zahnverluste kann
die gewählte Konstruktion ohne Funktionseinbuße auffangen.
Gleichzeitig erhält die Patientin die angestrebte Ästhetik einer
festsitzenden VMK - Brückenversorgung.
Selbst hochwertige
Kunststoffverblendmaterialien zeigen nach einigen Jahren
deutliche Farbveränderungen, die eine Neuanfertigung erfordern.
Die keramisch verblendeten TE=KO-Doppelkronen sind den z.Zt.
verfügbaren Kunststoffverblendungen in bezug auf Ästhetik,
Abriebfestigkeit, Lebensdauer und Farbbeständigkeit überlegen
und nach unserer Einschätzung trotz der höheren
Herstellungskosten die wirtschaftlichere Alternative.
Im allgemeinen
Handling sind keramisch verblendete TE=KO-Anker problemlos.
Allerdings sind die keramischen Verblendungen außerhalb des
Mundraumes durch Waschtische und Marmorböden gefährdet. Bei
Kontaktsportlern (Eishockey, Boxen etc.) sind die TE=KOVerblendungen
ebenso kritisch wie reguläre keramische Verblendungen, im
Unglücksfall aber leichter zu reparieren.
Dem klinischen
Praktiker steht ein Konstruktionsprinzip zur Verfügung, das die
klassische Indikation für Doppelkronen, den
stark reduzierten Restzahnbestand, erweitert. Ausgedehnte
Brückenversorgungen sind mit dem TE=KOPrinzip parodontal
optimal und ästhetisch gelungen zu versorgen. Daher kann auch
den jüngeren Patienten eine kompromißlos auf parodontale
Gesundheit konstruierte Versorgung gegeben werden, die bisher
aus ästhetischen Gründen eine ausgedehnte festsitzende Lösung
oder eine Ankerversorgung vorgezogen haben. Die höheren
Herstellungskosten werden durch die ausgesprochene
Langzeitperspektive einer solchen Versorgung aufgewogen. Durch
das einfache Konzept und die wirtschaftliche Herstellung halten
wir das TE=KO-System für die zukunftsträchtigste Variante der
derzeitigen Doppelkronensysteme.
Literatur
1.
BÖTTGER, H.: Das Teleskopsystem in der zahnärztlichen Prothetik,
Barth, Leipzig
2.
BÖTTGER, H. GRÜNDLER, H.: Die Praxis des Teleskopsystems, Neuer
Merkur, München 1970
3.
GRÄPEL, U., NIETHAMMER, W.: Der Geschiebe-Direktguß, Präzision
mit einfachen Mitteln, Dental-Labor, XXXVI, Heft 3/88
4.
LEHMANN, K. M., GENTE, M.: Doppelkronen als Verankerung für
herausnehmbaren Zahnersatz in: Ketterl, W. (Hrsg.):
Deutscher Zahnärztekalender 1988, Carl Hanser Verlag, München
1988
5.
LENZ/SCHINDLER/PELKA: Die keramikverblendete NEM-Konuskrone,
Quintessenz, Berlin 1992
6.
PRÖBSTER, L., WALL, G., WEBER, H.: Aufgußverfahren für
geschlossene Teleskop- und Konuskronen, Dental-Labor, XXXIX,
Heft 9/91
7. STARR, R. W.: Removable bridge-work,
porcelain cap crowns. Dent Cosmos 28, 17 (1886) Zitat
nach: Hoffmann-Axthelm, W: Geschichte der Zahnheilkunde,
Quintessenz, Berlin 1973
8.
STÜTTGEN, U., HUPFAUF, L.: Kombiniert
festsitzend-herausnehmbarer Zahnersatz in: Hupfauf, L. (Hrsg.)
Teilprothesen
9.
STUTTGEN, U.: Versuchsergebnisse mit NEM-Teleskopen an der
Universität Mainz, Persönliche Mitteilung 4/90
10.
WALL, G.: Keramik- und Hybridverblendung bei Doppel- und
Konuskronen, Dental-Labor, XXXIX, Heft 9/91
11. WALL, G.: Offenlegungsschrift DE 391
6592 A1/22.1l.90
|
|
Korrespondenzadresse:
Jörg Scholz
Buchenstra]3e 36
6090 Rüsselsheim
4.30-53 159 J5 |
DZW Spezial
Ausgabe 1/99 vom 17. Februar
1999
ZA Jörg Scholz berichtet über seine Erfahrungen mit NEM in der
zahnärztlichen Praxis:
Solide
Basis für ansprechende, haltbare und gut zu pflegende
Versorgungen
In der
Zahnheilkunde der alten Bundesrepublik gehörte es zum guten Ton,
zahntechnische Arbeiten in hochgoldhaltiger Legierung ausführen
zu lassen. Der Jahresverbrauch an Zahngold lag in der alten
Bundesrepublik in manchen Jahren über dem der gesamten USA. Erst
diverse Kostendämpfungsbemühungen führten zu einer zunehmenden
Verwendung preiswerterer Legierungen.
Die sofort
oder auch im längeren Verlauf der Tragezeit auftretenden
Korrosionserscheinungen der sogenannten Spargolde, die
öffentliche Diskussion um die toxischen Wirkungen des
Palladiums sowie die emotional angelegten Marketingkampagnen
der Edelmetallschmelzen haben die nüchterne Abwägung bei der
Legierungsauswahl erschwert.
Ohne Frage ist
die Duktilität hochgoldhaltiger Legierungen für Verarbeitung
oder Korrektur der Werkstücke angenehm, so daß der
Zahntechniker aus langjähriger Gewohnheit und mangelnder
Kenntnis dem Zahnarzt gerne hochgoldhaltige Legierungen für
optimale Arbeitsergebnisse empfohlen hat. Abgesehen von der
ästhetischen Faszination des Goldes haben diverse
Gerichtsverfahren gezeigt, daß auch andere als rein
fachliche Überlegungen den “Lockruf des Goldes“ ausgelöst
haben.
Abb.1 und 2:
Zustand bei jährlicher Routinekontrolle ohne vorherige
Reinigung bei einem mittelmäßigen Putzer nach acht Jahren
Beschränkt man
sich auf die werkstofftechnischen Eigenschaften der
Nicht-Edelmetall-Legierungen, fällt es schwer, diese Hinwendung
zum Gold nachzuvollziehen. NEM-Legierungen weisen höhere
Elastizitätsmoduln (E-Modul) auf, sind bioverträglich und stehen
für alle zahnärztlichen Anforderungen zur Verfügung.
Spezialisierte Laboratorien bieten in der Doppelkronentechnik
Einstückgußverfahren ohne Lot Laserschweißung an, die
hinsichtlich ihrer Biokompatibilität außerhalb der Kritik
stehen. Die Bestrebungen der Verordnungsgeber gehen dahin, das
Lot vollständig aus der Zahnheilkunde zu verdrängen. Auch der
aufmerksame Praktiker kennt seit langer Zeit die
Korrosionsneigung der Lötverbindung.
Am Beispiel des
Werkstoffs
Dentitan
(Austenal
Medizintechnik, Köln) sind die Eigenschaften einer titanhaltigen
Chrom - Kobalt Molybdän Legierung deutlich zu erkennen. In der
Praxis des Autors wird diese Legierung seit 1991 sowohl in der
Kronen- und Brücken - Prothetik als auch für
Doppelkronenversorgungen verwendet. Insbesondere die
legierungstechnisch problematische Teleskop-, Konus-, oder
Teleskop – Konus - Doppelkrone benötigt eine Legierung, die in
bezug auf Korrosionsfestigkeit und E-Modul höchsten Ansprüchen
genügen. Doppelkronen im Einstück-Aufgußverfahren ersparen Löt-
und Schweißverbindungen und zeigen nach Jahren noch identische
Werkstoffeigenschaften.
Die
NEM-Doppelkronen zeichnen sich nicht nur durch langjährig
stabile, sondern sogar zunehmende Haltekräfte aus, wie es
Laborversuche voraussagten. Die Erfahrung bestätigt diesen
Effekt, der aufgrund der außerordentlichen Präzision der
Aufgußtechnik möglich wird, in zahlreichen Fällen. Es entstehen
Mikrokaltverschweißungen der Oberflächen, die dem geringen
Abrieb des Primär- und Sekundärkronen entgegenwirken.
Voraussetzung für
diese langjährig stabilen Doppelkronenergebnisse ist der direkte
Aufguß des Sekundärteils auf die gefrästen Primärteleskope, die
lediglich durch eine Oxidschicht von der einschießenden Schmelze
für das Sekundärteil getrennt werden. Die immense primäre
Abzugskraft wird während der Fertigstellung der Arbeit im Labor
auf die notwendige “usability“ reduziert.
Die Erfahrungen in
vielen Praxen haben gezeigt, daß bei dieser Verfahrensweise im
Vergleich zum hochgoldhaltigen Teleskop der Vakuumeffekt eine
größere Rolle spielt. Die Verschlußkraft des “Ventils“
Doppelkrone ist aufgrund der geringen Toleranzen geeignet, die
Haftkraft zu erhöhen. Allen Anwendern ist die Erfahrung
gemeinsam, niemals Klagen über nachlassenden Halt des Ersatzes
zu hören. In der Einarbeitungsphase gewöhnen sich die
Praxisteams nur langsam an die vollkommen anderen Haltekräfte,
die auf kleinster Fläche erzielt werden.
Die eigentliche
Friktion der Doppelkrone entsteht an einem zervikalen
Umlaufbereich von etwa einem bis 1,5 Millimeter. Der übrige
Bereich der Primärkrone ist zahnorientiert modelliert und gibt
dem Techniker einen erheblich größeren Gestaltungsspielraum bei
der Verblendung des Ersatzes. Das hohe E-Modul des Dentitan
ermöglicht insbesondere bei den heute kunststoffverblendeten
Doppelkronen Primärschichtstärken von etwa 0,2 Millimeter und
0,3 Millimeter fazial am Sekundärteil. In der Summe benötigt
also der Techniker nur einen Teil der bei hochgoldhaltigen
Legierungen notwendigen Schichtstärke für das Metall. Das
Resultat sind entsprechend ästhetische und technisch
überzeugende zahntechnische Werkstücke.
In der Folge
kommen die Zahnärzte und Patienten ohne den späteren Einbau von
Hilfsteilen und das früher praktizierte Einkürzen der
Primärteleskope aus, und können die übrigen unbestrittenen
Vorzüge der Doppelkronen langjährig nutzen. Friktionsstifte sind
in diesem Licht mit einem Fragezeichen zu versehen, da alle
beweglichen Teile auf Dauer einem Verschleißrisiko unterliegen
und für bakterielle Besiedlungen zugängliche Räume bieten.
Die geringe
Neigung zur Plaqueanlagerung ist für Dentitan typisch und
unterstützt die ausgezeichnete Gewebeantwort des marginalen
Parodonts auf die Versorgung. Typischerweise ist der Träger
einer umfangreichen Doppelkronenversorgung parodontal
vorgeschädigt und auf eine gute Mundhygiene angewiesen. Da
ausgedehnter Zahnverlusten der Regel auf mangelnde Bereitschaft
zur geeigneten Mundhygiene zurückgeht, wird es der Behandler in
der Praxis mit allenfalls mittelmäßig motivierten Patienten zu
tun haben. Die signifikant geringere Plaqueanlagerung
erleichtert nicht nur bei der a priori leicht zu pflegenden
Doppelkronenversorgung die Pflege, sondern auch bei
festsitzenden Kronen und Brücken (Abb. 1 und 2).
Bis heute hält
sich die Auffassung, daß NEM-Legierungen nur schwer ästhetisch
zu verblenden sind. Die graue Farbe der Oxide brächte Grautöne
und leblose Farben mit sich. Die von spezialisierten Laboren
hergestellten keramischen Verblendungen scheuen keine
Vergleiche, erfordern aber eingearbeitete Techniker und
hochwertige Verblendmassen. Die ideale Bindung der Keramik an
das Metalloxid von Dentitan bietet jedoch einen sicheren
Haftverbund, der bei Goldlegierungen nur durch
Nicht-Edelmetall-Zusätze wie Iridium ansatzweise erzielt werden
kann.

Abb. 3:
Beispiel für eine gelungene Verblendung
In der
Vergangenheit sind in der Praxis des Autors sowohl
festsitzende Kronen- und Brückenprothetik als auch
herausnehmbare Brücken auf Doppelkronenbasis keramisch
verblendet worden (Abb. 3). Generell stellten sich nach
einem achtjährigen Rückblick so selten abgeplatzte
Verblendungen ein, daß immer noch die erste Packung eines
Verblendreparaturmaterials in der Zwei – Behandler - Praxis
des Autors steht und verfällt.
Unterdessen
ist es nicht mehr notwendig, die teure keramische
Verblendung von Doppelkronen anzustreben, um ästhetische
Ergebnisse zu erhalten. Moderne Polymerglas-Materialien
geben dem Techniker eine Reihe von Optionen zur ästhetischen
Gestaltung, die der Keramik ohne weiteres nahekommen. Ob die
Gesundheitspolitik in Zukunft noch hochwertige
Metall-Keramik im GKV-Segment zuläßt, wird sich zeigen. Mit
den entsprechenden Werkstoffen wird eine
Kunststoffverblendung als Kassenlösung durchaus den
durchschnittlichen Patienten ansprechende Ergebnisse
liefern, die auf der Basis eines kostengünstigen NEM-Gerüsts
biologisch einwandfrei und extrem belastbar sind. Für den
Behandler sinkt das Risiko im Sinne eines Verlusts oder
einer irreparablen Fraktur der Metall-Keramik, das im Rahmen
der politischen Honorarkürzung nicht tragbar erscheint.
Für die anspruchsvolle
Klientel aber bietet Dentitan als NEM-Legierung in
zunehmendem Maße die Basis für hochwertigen Zahnersatz zu
“value for money“ - Bedingungen und ist als
Allroundlegierung in der zahnärztlichen Prothetik geeignet.
Daß die vollkeramischen Verfahren in der anspruchsvollen
Frontzahnversorgung sowie der lnlaytechnik schon seit Jahren
unangefochten die Metall-Keramik überholt haben, ist dazu
kein Widerspruch, sondern Ausdruck eines pragmatischen
Entscheidungsprozesses jenseits aller Marketingbemühungen,
den jedes Zahnarzt – Zahntechniker - Team immer wieder neu —
unabhängig von den unterschiedlichen Vorgaben durch
Patienten und Politik — zum Ergebnis zu führen hat.
|
Für weitere Informationen wenden Sie
sich bitte an:
|