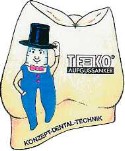|



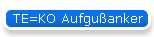
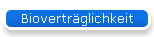

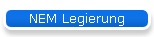
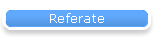

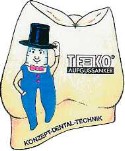
| |
Doppelkronentechnik
Zum friktiven Kontakt in der
Doppelkronentechnik
Referat von
Prof. Dr. U. Stüttgen
|
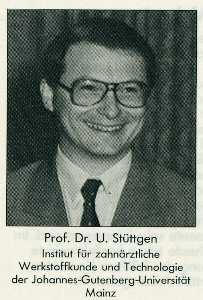 |
—
Prof. Dr. U.
Stüttgen —
—
(Redaktionell überarbeitete
Fassung eines Referates, das anlässlich des NEM-Symposiums in
Stuttgart am 28.Januar 1989 gehalten wurde.)
|
Es ist wohl allgemein bekannt, daß
es zwischen denen, die die parallelwandige Teleskopkrone und jenen,
die die Konuskrone bevorzugen, hin und wieder
Meinungsverschiedenheiten gegeben hat. Ich selbst zähle mich zu
denen, die gerne parallelwandige Teleskopkronen anwenden. Da meine
Ausbildung an der Universität Düsseldorf erfolgte, ist meine
Vorliebe für parallelwandige Doppelkronen leicht zu verstehen.
Gegenüber den edelmetallfreien Legierungen in der
Doppelkronentechnik war ich lange Zeit sehr kritisch eingestellt.
Grundsätzlich ging ich davon aus, daß das Maß, an dem die
NEM-Legierungen gemessen werden sollten, die dauerhaft
funktionierende Teleskopkrone sein müßte
|
-
Zur
Funktion von konischen und parallelwandigen Doppelkronen
Meine ersten speziellen Ausführungen
betreffen eine Veröffentlichung von Prof. K.H. KORBER aus Kiel.
Dort war von einem Modellversuch die Rede, in welchem Ringe aus
Silberstahl 1. über parallelwandige und 2. über konische Zapfen
geschoben werden sollten. Es stellte sich heraus, daß sich die
Ringe auf den parallelwandigen Zapfen frühzeitig verkanteten und
sich dadurch nicht in ihre vorgesehene Endposition bringen
ließen. Ganz anders verhielt es sich bei den konischen Zapfen.
Für sie war das Erreichen des endgültigen Paßsitzes kein
Problem. Dieser experimentelle Befund hat uns in Düsseldorf sehr
beunruhigt, denn aus klinischer Erfahrung wußten wir, daß die
Teleskopkrone — allen Modellversuchen zum Trotz —
bestens funktionierte.
Zur
Erklärung der scheinbaren Widersprüche sei folgendes ausgeführt.
Im vorliegenden Modellversuch handelte es sich in beiden Fällen
um zwei nahezu starre Systeme, die aufeinander-geschoben werden
sollten. Die Betonung sei ausdrücklich auf das Wort “starr“
gelegt, da alles, was “starr“ ist, und sich damit einer
elastischen Verformung entgegenstellt, für die Herstellung
parallelwandiger, reibschlüssiger Verbindungen weniger geeignet
ist. Zu diesem Phänomen werden bei der Besprechung des
Friktionskontaktes zwischen Doppelkronen noch weiterführende
Erklärungen folgen. Die Konuspassung hingegen läßt sich gerade
mit “starren“ Teilen erzielen. Daß die parallelwandigen
Teleskope dennoch dauerhaft funktionieren, läßt sich an dem
Beispiel einiger Musikinstrumente demonstrieren. Um
z.B. eine Querflöte tiefer zu stimmen, kann man ganz
einfach das Mundstück - mit teleskopierender Passung zum
Mittelstück etwas herausziehen und damit die Gesamtlänge des
Instrumentes, in dem die Luftsäule zum Schwingen gebracht wird,
vergrößern. Natürlich darf das Instrument in dem auseinander
gezogenen Zustand nicht auseinander fallen! Hier wäre also eine
Konuspassung ganz ungeeignet. Die parallelwandigen Passungen
kennen wir jedoch nicht nur bei Blasinstrumenten, sondern man
findet sie häufig auch bei Tabakpfeifen. Einige Hersteller
verarbeiten sogar für die zylindrische Passung des Mundstücks im
Pfeifenkopf konfektionierte Kunststoffteile.
Über die
elastische Verformung der parallelwandigen Kunststoffteile läßt
sich dann das Pfeifenmundstück mühelos “teleskopierend“ in die
Matrize des Pfeifenkopfs hinein schieben. Auch in diesem
Beispiel findet man also die Kombination von zylindrischer,
reibschlüssiger Passung und der Werkstoffeigenschaft
“Elastizität“. Natürlich gibt es neben den teleskopierenden
Pfeifenmundstücken auch solche mit einer konischen Passung
zwischen Mundstück und Pfeifenkopf. Dies zum Trost für alle
Konus-Kronen-Anhänger.
Bei
Glasstopfen von Glasgefäßen hingegen zeigt sich, daß sich mit
spröden Materialien parallelwandige, reibschlüssige Passungen —
wenn überhaupt — nur mit einem sehr großen technischen Aufwand
realisieren lassen. Hier hat man es mit konischen
Steckverbindungen deutlich einfacher.
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß bei relativ
elastischen Materialien (mit geringem Elastizitätsmodul) im
Regelfall keine Schwierigkeiten bei der Herstellung von
parallelwandigen, teleskopierenden Verbindungen bestehen. Immer
dann, wenn es an elastischer Verformbarkeit fehlt, ist man
jedoch besser beraten, auf konusförmige Verbindungen
auszuweichen.
|
Um die bei dem Friktionskontakt von
Doppelkronen bestehenden Probleme aufzeigen zu können, sei die
folgende Versuchsanordnung beschrieben. Wird die Außenfläche
eines Außenteleskops mit Dehnungsmeßstreifen bestückt (Abb. 1),
so läßt sich feststellen, daß das gesamte Außenteleskop —
z.B. aus der hochgoldhaltigen Legierung
Degulor M — verformt wird. Bei dem hier
abgebildeten Außenteleskop handelt es sich — wie man gleich noch
sehen wird — im eigentlichen Sinne um einen
“getarnten Druckknopfanker“. Der Kraftverlauf während der in
einer Verschleißprüfmaschine durchgeführten Verschleißfahrten
zeigt deutlich die Charakteristika von Druckknopfankern; d.h.,
daß es in der Anfangsphase des Fügens bzw. Trennens zu einem
Ausdehnen des Außenteils kommt, das sich im Sinne eines
Zurückfederns anschließend wieder elastisch zurückstellt. Auf
dem nächsten Bild (Abb. 2) sieht man den Primäranker mit seinen
unterschiedlichen Bereichen, die mit Farblack sichtbar gemacht
wurden.
Allgemein
stellt sich an dieser Stelle die Frage, inwieweit es heutzutage
der Zahntechnik möglich ist, “Parallelwandigkeit“ überhaupt
zu erreichen. Zur Beantwortung dieser Frage haben wir einige
Teleskope vermessen und feststellen können, daß wirklich
parallelwandige Teleskope so gut wie nicht vorkommen. Ein
kleiner Konuswinkel von ein bis zwei Grad stellt sich
offensichtlich beim Fräsen der Außenflächen schon von alleine
ein. Dies liegt u.a. am Spiel der rotierenden Fräswerkzeuge.
Wenn man seine parallelwandigen Teleskope einmal nachmessen
würde, wäre man vor einigen Überraschungen bestimmt nicht
sicher.
Zur
Verschleißprüfung von Teleskopkronen benutzen wir eine spezielle
Verschleißprüfmaschine. Der Primäranker sitzt auf einer Membran,
die mit acht Dehnungsmeßstreifen bestückt ist (jeweils vier auf
der Vorder- und Rückseite). Die Teleskope bzw. die
teleskopieren den Verbindungen (es können auch Geschiebe sein)
werden immer zusammen mit ihren Frässockeln der Meßmembran
aufgespannt. Hierdurch lassen sich Übertragungsfehler
weitestgehend ausschließen. Jeder Prüfkörper muß in dieser
Maschine 10.000 Verschleißfahrten hinter sich bringen. Die
Sekundäranker werden über einen Schubkurbeltrieb den
Primärankern aufgeschoben bzw. von den Primärankern abgezogen.
Bei dem in Abb. 2 gezeigten “Druckknopfteleskop“ läßt sich mit
einer solchen Versuchsanordnung selbst nach 2.000 Fahrten noch
kein Friktionsverlust darstellen. Eine hochedelmetallhaltige
Legierung, wie z.B. Degulor M, hat einen E-Modul von ca. 100.000
N/mm2 und ermöglicht offenbar eine fehlerähnliche
Verformung. Wenn wir uns jetzt einmal die Haftreibungskräfte von
Doppelkronen im Verschleißversuch anschauen, so finden wir zu
Beginn der Verschleißprüfungen immer wieder deutliche
Einschleifphasen, die mit einem Friktionsverlust verbunden sind.
Dies gilt ausdrücklich für edelmetallhaltige teleskopierende
Verbindungen. Neuere Untersuchungen mit edelmetallfreien
Legierungen ergeben diesbezüglich nahezu kontroverse Ergebnisse.
Die
Einschleifvorgänge spielen für die Funktionsfähigkeit von
teleskopierenden Teilen aus edelmetallhaltigen Legierungen eine
große Rolle. Letztlich stellt sich bei diesen Legierungen die
dauerhafte Friktion durch ein Einschleifen der teleskopierenden
Flächen nahezu von alleine ein. Man kann davon ausgehen, daß
sich diese Einspielvorgänge bis ungefähr zur 1.500
Verschleißfahrt hinziehen. Geht man davon aus, daß eine
inkorparierte Teleskopprothese ca. dreimal am Tag aus dem Mund
genommen wird (morgens, mittags und abends), so erscheint es
zweckmäßig, die endgültige Friktionskraft von Teleskopprothesen
in einem Zeitraum von mehr als einem Jahr einzustellen. In jedem
Fall ist es ratsam, den gewünschten Friktionswert nicht schon in
den ersten Sitzungen nach dem definitiven Einsetzen von
Teleskopprothesen durch “Ausschleifen“ der Außenteile einstellen
zu wollen.
|
Wenn man
nun weiß, wie schwierig es ist, teleskopierende Passungen
herzustellen, macht man sich zwangsläufig Gedanken darüber, wie
es denn einfacher gehen könnte. Natürlich denkt man in diesem
Zusammenhang auch an Kunststoffteile, die auf vielen Gebieten
der Technik konstruktive Probleme lösen helfen. Ein Patent
beschreibt z.B. Kunststoffringe, die in Außenkronen eingelegt
werden können, um den friktiven Kontakt zwischen Innen- und
Außenteil herzustellen. Ein weiterer Vorschlag geht dahin, die
teleskopierenden Teile über eine Kunststoffschicht auf der
Innenfläche des Außenteleskops “passend“ zu machen und dadurch
gleichzeitig besonders geeignete “Laufflächen“ zu erzielen.
Tatsächlich besitzen die elastisch verformbaren Kunststoffe
Eigenschaften, die für die Herstellung teleskopierender Elemente
sehr interessant sind. Im Bereich der Attachments gibt es heute
schon konfektionierte Kunststoffteile zur Aufrechterhaltung des
friktiven Kontaktes. Beispielhaft sei hier der
Preci-Vertix‘-Anker genannt.
Versucht
man elastische Hilfsteile aus Metall in die Hülsenkronen
einzubauen, so kommt man zwangsläufig auf die Idee, elastische
“Friktionsstiftchen“ — analog dem
Rillen-Schulter-Stift-Geschiebe — zu
verwenden. Die Friktionsstiftchen bieten in diesen Fällen den
Grad an elastischer Verformbarkeit, die der Kronenwandung aus
materialspezifischen Gründen ggfs. fehlt. In solchen Fällen
stellt der Friktionsstift, der zusätzlich noch aktivierbar ist,
eine geeignete Lösung für das “teleskopierende Passungsproblem“
dar.
Abb. 3
zeigt ein parallelwandiges Teleskop aus- der Legierung Dentitan®.
Teleskope dieser Art werden momentan in der schon angesprochenen
Verschleißprüfmaschine untersucht. Setzt man die Sekundärkrone
auf den Primäranker, so läßt sich bei der gezeigten Doppelkrone
beobachten, wie die Sekundärkrone — wie von einem Luftkissen
getragen —auf das Innenteil herabsinkt. Beim
Trennen dieser Doppelkronen verspürt man einen deutlichen
Unterdruck. Die Haltekräfte entstehen also bei den hier
vorgestellten Doppelkronen weniger durch eine Abb. 3 elastische
Verformung der Sekundärkrone als vielmehr durch ein beim
Abziehen der Sekundärkrone entstehendes Vakuum. Die entstehenden
“Haft- und Gleitreibungskräfte“ lassen sich ohne weiteres bis
zur 10.000 Verschleißfahrt nachweisen. Es handelt sich hier wohl
um die erste Teleskopkrone, die in einer Verschleißmaschine
Friktionskräfte messen ließ, die im eigentlichen Sinne gar keine
Friktionskräfte waren. Neben geringfügigen mechanischen
Kontakten waren es wohl vor allem die Luftviskosität und der
durch sie bewirkte Unterdruck, der die gemessenen Kräfte
verursachte.
Die zuletzt
angesprochenen Untersuchungen haben zum Ziel, edelmetallfreie
teleskopierende Verbindungen in einem Verschleißtest auf
ihre dauerhafte Funktion zu überprüfen. Die ersten Ergebnisse
wecken im vorliegenden Fall einige Hoffnungen. Für eine
Empfehlung in dieser oder jener Richtung reichen die Meßdaten
zur Zeit leider noch nicht aus. Man darf jedoch auf das
endgültige Resultat gespannt sein.
|
Drucktechnische Wiedergabe des Vortrages mit freundlicher
Genehmigung des Verfassers durch:
Krupp
Medizintechnik GmbH
Harkortstraße 65. Postfach 1021 42. D-4300 Essen 1
Telefon:
(0201) 725-0 Telex: 85 718-13 . Telefax: (0201) 7257911
|
Für weitere Informationen wenden Sie
sich bitte an:
|